|
Home >
Standortsansprache >
Einleitung >
Vorgehensweise ...
![]()
Ansprache der Hauptwaldstandorte
|
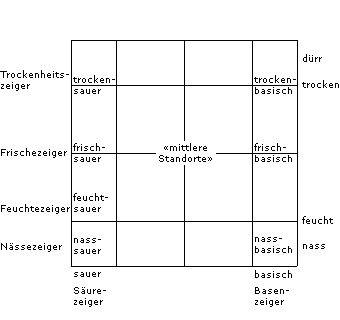 |
| Beispiel eines Oekogramms mit den Bereichen der Zeigerpflanzengruppen |
Wenn wir Oekogramme verwenden, dürfen wir folgendes nicht vergessen:
Gelingt es uns nun, die standörtlichen Verhältnisse des anzusprechenden Bestandes mit Hilfe der Zeigerpflanzen, der Bodenmerkmale und gesundem Menschenverstand im Oekogramm einzutragen, so können wir auf den Standortstyp schliessen. Dazu dienen uns Oekogramme, die mit den Bereichen der Standortstypen «geeicht» sind.
In Kapitel «Die Oekogramme der Hauptwaldstandorte» sind solche Oekogramme für jede Region und jede Höhenstufe zu finden.
BeispielZur Beurteilung des Standortes verwenden wir das Oekogramm «hochmontan», Region 1. Bereits mit Hilfe unserer Beobachtungen können wir aussagen, dass wir uns sicherlich nicht im nassen und auch nicht im trockenen Bereich befinden. Schauen wir, was uns einzelne Pflanzen anzeigen, und versuchen wir damit, den Bereich im Oekogramm zu umreissen, der unserem Standort am ehesten gerecht wird. Zu diesem Zweck nehmen wir die wichtigsten Arten unseres Waldes auf und gehen die Liste der Zeigerpflanzen durch: Säurezeiger (alle Höhenstufen):
Beurteilen wir zuerst die Achse «sauer-basisch»: Aus dem Fehlen von Kalkzeigern schliessen wir, dass wir den Standort nicht im rechten Teil des Ökogrammes eingliedern dürfen. Auch der linke Bereich trifft nicht zu, da starke Säurezeiger nur mit geringem Deckungswert auf leicht erhöhten Kleinstandorten vorhanden sind. Viele «Mittlere»-Arten und Moderzeiger weisen uns auf das Zentrum des Oekogrammes hin. Auch auf der Achse «nass-dürr» können wir den Standort leicht eingliedern: Trockenheits- und starke Nässezeiger fehlen. Viele Arten zeigen uns «frische» Verhältnisse an. Einige charakterisieren den Standort als «frischfeucht» bzw. «feucht». Unser Standort lässt sich somit irgendwo unterhalb der Mitte, jedoch oberhalb der Linie «feucht» eingliedern. Die Humusform entspricht einem typischen schwach sauren Mull mit örtlichen Übergängen zu Moder. Die erkennbare bräunliche Farbe der Mineralerde zeigt eine Bodenentwicklung mit beginnender Gefügebildung und normaler Wasserdurchlässigkeit an. Damit zeigen auch das Wasser- und Nährstoffspeichervermögen mittlere Verhältnisse im Wurzelraum an. Eine Kalkgrenze liegt tiefer als 80 cm. Wir können nun den Bereich im Oekogramm markieren, in dem sich unser Standort befindet (siehe oben). Wir sehen, dass dieser Bereich vor allem vom «typischen Hochstauden-Tannen-Fichtenwald (50)» beschrieben wird. Etwas wird noch der «Hochstauden-Tannen-Fichtenwald mit Pestwurz (50P)» tangiert. |
| Vorgehensweise bei einer standortskundlichen Ansprache | ||
| - | Beobachtung und Abgrenzung des anzusprechenden Waldteiles | |
| - | Übersichtskarte der Standortsregionen | |
| - | Ein Höhenstufenmodell | |
| - | Überprüfung Sonderwaldstandorte | |
| - | Ansprache der Hauptwaldstandorte mit Hilfe von Oekogrammen | |
| - | Überprüfung der Ansprache |
< zurück |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
weiter > ![]()